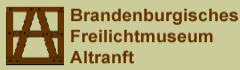
16259 Bad Freienwalde OT Altranft, Am Anger 27 Tel: 03344 414300 Fax: 03344 414325
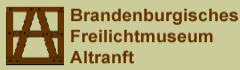 |
Gestern und Heute gemeinsam erleben 16259 Bad Freienwalde OT Altranft, Am Anger 27 Tel: 03344 414300 Fax: 03344 414325 |
| Sie sind hier: Startseite > Presse > Archiv > wissenschaftliche Themen | |
Auszüge aus der Sammlungskonzeption des Freilichtmuseums1. Vorwort2. Das Museumsprofil und deren Sammlungsaufgaben 3. Die Sammlungsstrategie 4. Thematische Schwerpunkte 5. Zusammenfassung 1. Vorwort Der Ruf nach Sammlungskonzeptionen wird leider meist nicht von wissenschaftlichen, sondern vielmehr aus verwaltungstechnischen Positionen getragen, die den Wunsch nach einer planbaren Größe mit einer Endzielprojektion vereinen. Die Museumsmitarbeiter sprechen von einer Sammlungskonzeption im Sinne einer Strategie, bei der inhaltliche Leitlinien und Grenzen definiert werden. Weil es eine starre Sammlungskonzeption nicht geben kann; ist eine Überarbeitung und Anpassung an das Museumskonzept alle fünf Jahre ratsam. Das Freilichtmuseum Altranft hat in seiner Entwicklungskonzeption klare Leitlinien für den Aufbau des Museums und damit auch der Sammlungen festgelegt. Die hier vorliegende Sammlungskonzeption ist auf der Grundlage der "Entwicklungskonzeption" fortgeschrieben und konkretisiert worden. Auf der Arbeitstagung der Freilichtmuseen 1996 auf den Glentleiten, wurde die Problematik der Sammlungskonzeption diskutiert. So zeigte sich diese Problematik in der Schweiz, Österreich und Deutschland gleichgelagert, so daß zukünftige Tagungen dieses Thema aufgreifen werden. Ist es vor den Toren des Museums noch "Strandgut" der Geschichte, wird es als Sammlungsbestandteil zum Kulturgut, einem historischem Dokument mit dem Anspruch auf Unvergänglichkeit. Zweifellos steht mit der Aufgabe eines Museums des Sammelns und Bewahrens, die Aufgabe der Unterbringung des Kulturgutes. Dieser Sachverhalt wird zum Schreckensschrei jeden Trägers und jeder Verwaltung, verzweifelt lautet er "Sammlungskonzeption" in einer anderen Sinnesbedeutung. Wenn erst einmal verstanden wird, daß die Depotbestände intergraler Bestandteil der Sammlungen sind, eben der andere Teil der Ausstellung, dann sind die Magazinbestände keine Frage der Wertigkeit sondern des Standortes. Somit hat der Ort Depot mehr noch als die Ausstellung, nicht nur die Lagerfunktion, sondern ist auch Ort der Bewahrung mit den Themen der aktiven und passiven Konservierung. Nicht zuletzt sei noch angemerkt, daß Museumsgut kein Umzugsgut ist. Hier entstehen Schäden und Verluste, die bei weitem höher sind, als in Ausstellungen angerichtet werden können. 2. Das Museumsprofil und deren SammlungsaufgabenMuseen sind in den Statuten des Internationalen Museumskomitees (ICOM) definiert als " eine nicht gewinnorientierte ständige Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die der Öffentlichkeit zugänglich ist und materielle Zeugnisse über den Menschen und seine Umwelt erwirbt, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt zum Zwecke des Studiums, der Erziehung und Bildung und der Erbauung". (1986) Ziel der Museumsarbeit ist neben dem Sammeln und Bewahren, die Erforschung der regionalen und überregionalen Geschichte und die Weitervermittlung der Erkenntnisse durch museale Präsentation. Diese museale Arbeit ist ein bedeutender, in Zukunft noch zunehmender Teil der gesamten Kulturarbeit. Das ansteigende heimatkundliche Interesse der Bürger, der Drang nach Entdeckung und Selbstverwirklichung, ist Ausdruck für das steigende Bedürfnis an einem musealen Kulturangebot. Museen leisten einen wichtigen Beitrag zur Identifikation der Menschen mit Ihrer Region und mit der Kulturepoche, in der sie leben. Auch der Zunahme der "freien Zeit", ausgelöst durch verschiedene soziale Prozesse, müssen die Museen als Standbein der Kulturlandschaft des Landkreises Märkisch Oderland und über die Landgrenzen hinaus Rechnung tragen. Das Brandenburgische Freilichtmuseum Altranft ist 1990 mit ersten Dauerausstellungen an die Öffentlichkeit getreten. Zuvor gab es seit 1975 laut Kreistagsbeschluß eine langwierige, komplizierte Aufbau- und Etablierungsphase. Nachfolgende Ausführungen zur Sammlungskonzeption dieses Freilichtmuseums sind immer unter folgendem Gesichtspunkt zu betrachten: Der große Unterschied zwischen einem "Museum der Alltagsgeschichte" und einem "Freilichtmuseum der Alltagskultur" ist die besondere Situation, daß außer der beweglichen Sachkultur auch die unbewegliche Sachkultur, die Gebäude, in die Sammlungsdokumentation einbezogen werden. Die der Öffentlichkeit zugänglichen Ausstellungen stellen vor allem regional spezifische Haus- und Siedlungsformen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert dar. Das gutsherrschaftliche Schloß mit einem denkmalgeschützten Park, sowie Bauern- und Gutsarbeiterhäusern, Schmieden, Scheunen, Spritzenhaus und Schule geben mit thematischen Ausstellungen Einblick in die volkskundlichen Bereiche. 3. Die SammlungsstrategieGrundlage der Ausstellungen sollen in erster Linie die materiellen Zeugnisse sein, die sich in Form von historischen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Arbeitsgeräten, Mobiliar, Hausrat u.a.m., aber auch in Gestalt der ideellen Zeugnisse in Form von Archivalien erhalten haben. Angestrebt wird die möglichst realistische Darstellung verschiedener historischer Zeitabschnitte, um Geschichte erlebbar zu machen. 4. Thematische SchwerpunkteSeit der Konsolidierungsphase des FMA ab etwa 1995 besteht die Möglichkeit, beim Erwerb von Sammlungsgut gezielt sichten und auswählen zu können. Dabei sollte jede Behandlung von Exponaten unter dem Merksatz stehen: Erhaltung und Bewahrung von typischem oder und repräsentativem Sammlungsgut ist möglich, wenn es zuvor für "sammlungswürdig" befunden wurde. Der Erwerb und Zugang von Museumsgut erfolgt durch - Schenkungen, Übergabe von Nachlässen - gezielter Ankauf für unmittelbare Ausstellungen Dabei ist eine konzeptionelle Auswahl als Belegstück erforderlich, immer unter dem Gesichtspunkt der Bewahrfunktion. Das Präsentationsziel muß vorliegen. Entsprechend der landesweiten Bedeutung des Freilichtmuseums ist es notwendig, unabhängig von derzeitigen Möglichkeiten der Umsetzung, verantwortungsbewußt und konzeptionell abgestimmt, eine Schwerpunktkartei zu formulieren:
Nach gewisser Abdeckung des agrarethnographischen Sammlungsgutes wird eine stärkere Orientierung auf den handwerklich, kleinbürgerlichen Bereich gelegt. Die Aufarbeitung und Systematisierung des Sammlungsbestandes erfolgt seit 1995 durch die Einführung des Inventarisationsprogramms "First Rumos", alle Objekte werden systematisiert abgelegt. Generell sollte bedacht werden, daß Haus- und Hofexponate seit der Mitte unseres Jahrhunderts schneller und spurloser verschwinden, seit die Entwicklung der sog. "Wegwerf Gesellschaft" rasant zunimmt. Andererseits wird die Auswahl zunehmend schwieriger, je näher die Sammlung an die Gegenwart herangeführt wird. Umfangreiche Projekte für die Erhaltung der noch existierenden Regionalbestände, die einerseits erst einmal durch die Gründung einer Vielzahl von Heimatstuben und Heimatvereinen aufgefangen werden, sind erforderlich. Hier werden zukünftig Aufgaben bezüglich der Beratung und Hilfestellung an das Freilichtmuseum herangetragen. Bedingt durch die steigende Zahl der Sanierungs- bzw. Abrißmaßnahmen im ländlichen Raum ist es dringend erforderlich, die Aufbewahrung von Baugruppenteilen und wertvollen originalen Architekturdetails zu intensivieren. Alle Aufgaben erfordern eine klare Abstimmung im Zusammenhang mit der Bereitstellung bzw. Schaffung entsprechender Depots. 5. ZusammenfassungDie ideale Sammlungsstrategie wird es in Museen nicht geben. Die Qualifizierung von Kriterien zum Sammeln wird ein dauernder Prozeß in der museologischen Diskussion bleiben, bei der das Sammeln als Grundlage der Erforschung der Sachkultur offen betrieben wird und die wissenschaftlichen Erkenntisse auf die Sammlungsstrategien ordnend zurückwirken. Auch in der Präsentation der Forschungs- und Untersuchungsergebnisse wird sich die Spannweite zwischen dem Gebäude als denkmalwürdiges Objekt einerseits bis zum Objekt einer ganzheitlichen Präsentation andererseits auftun. "Sammelpolitik" Jede Museumsleitung sollte eine schriftliche Darstellung ihrer Sammelpolitik annehmen und veröffentlichen. Diese Politik sollte von Zeit zu Zeit übeprüft werden, mindestens jedoch einmal alle fünf Jahre. Erworbene Objekte sollten den Zielen und den Aktivitäten des Museums entsprechen und von einem Nachweis ihres rechtmäßigen Vorhandenseins begleitet werden. Alle mit dem Erwerb zusammenhängenden Bedingungen oder Einschränkungen sollten in einem Dokument über den Eigentumsübergang eindeutig erläutert werden.... Erwerbungen, die nicht der festgelegten Sammlungspolitik entsprechen, sollten nur unter ganz außergewöhnlichen Umständen getätigt werden...und im Interesse der betreffenden Objekte sowie des nationalen oder eines anderen Kulturerbes und unter Berücksichtigung der speziellen Interessen anderer Museen." (ICOM , 1986) |
|